Der blinde Fleck der Intellektuellen – Wie sie mit Ignoranten sprechen
Barbara Kolocek | 28.05.2025
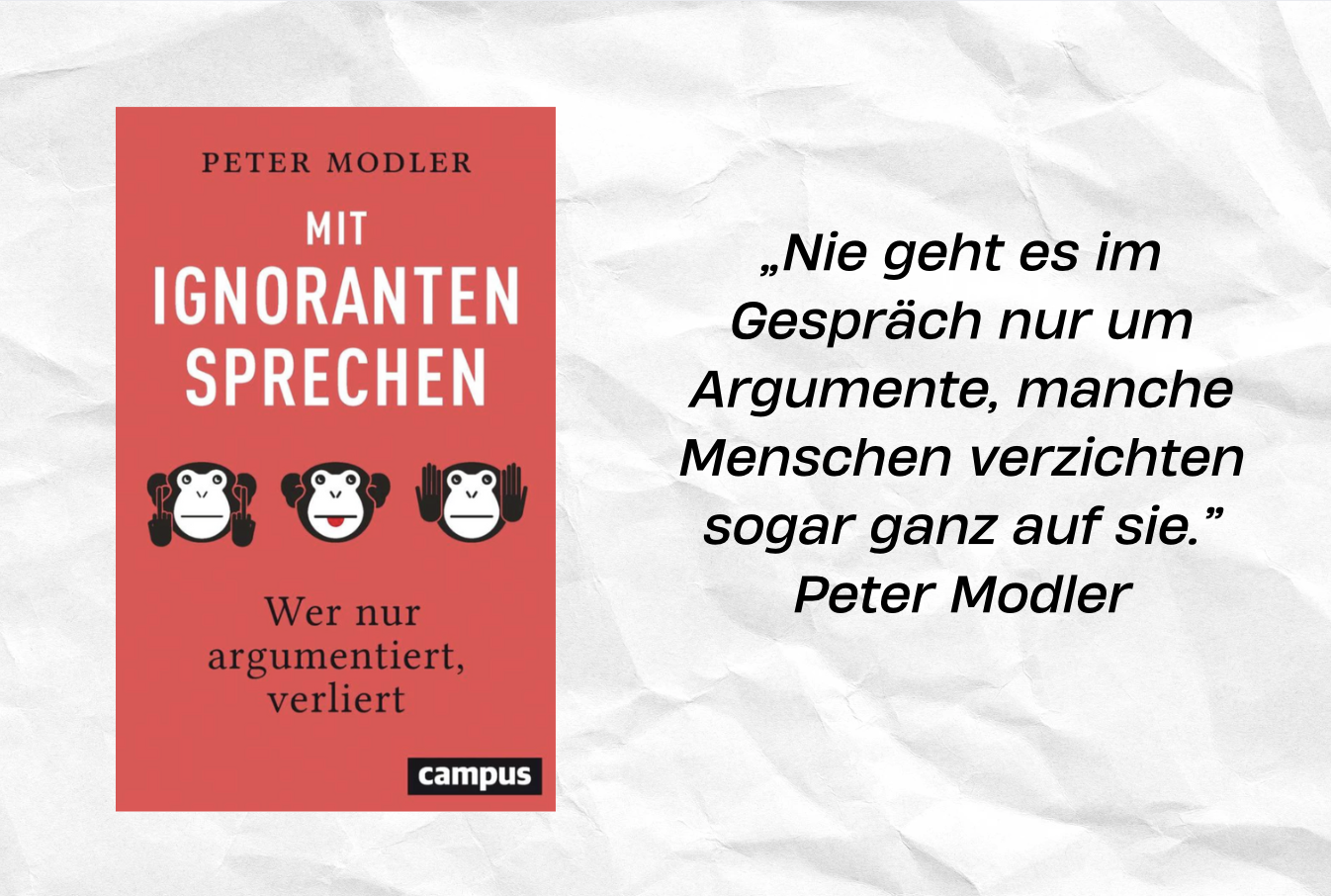
Unser ZP Face Barbara Kolocek empfiehlt das Buch „Mit Ignoranten sprechen“ – ein echter Augenöffner für alle, die die unsichtbaren Regeln hinter Gesprächen verstehen und souveräner mit Hierarchien, Machtspielen und Provokationen umgehen wollen. Es zeigt, wie Techniken wie Basic Talk (kurze Sätze, Themenwechsel) und Move Talk (Körpersprache) gezielt eingesetzt werden, um sich gegen verbale Angriffe zu wehren. Wer künftig bewusster auf solche Mechanismen reagieren möchte, sollte unbedingt weiterlesen! 👇🤓
Eine Buchrezension von Barbara Kolocek, Dozentin Arbeits- und Organisationspsychologie, Trainerin, Moderatorin; arbeitneudenken.org
Peter Modler analysiert in seinem Buch die kommunikativen Mechanismen in öffentlichen Debatten und innerhalb von Unternehmen. Besonders beleuchtet er den Umgang mit Ignoranten – ein Aspekt, der für die Zukunft demokratischer Diskurse von entscheidender Bedeutung ist.
Was dieses Buch nicht ist:
- Es ist kein Leitfaden zur Bekämpfung des Populismus.
- Es ersetzt keine politische Strategieentwicklung.
- Es untersucht nicht die Ursachen für den Erfolg populistischer Bewegungen.
Das eigentliche Ziel des Autors ist es, seinen Lesern und Leserinnen praktische Werkzeuge an die Hand zu geben, um in direkten Konfrontationen mit Ignoranten wirksam zu agieren.
Gleich zu Beginn des Buches werden zwei Kommunikationssysteme verglichen:
Die US-amerikanische Soziolinguistin Deborah Tannen stellte bereits vor Jahrzehnten fest, dass es zwei grundlegend verschiedene Kommunikationsmuster gibt: eines mit einer hierarchischen (vertikalen) Struktur und eines mit einer gleichwertigen (horizontalen) Struktur.
Vertikale Kommunikation: Menschen, die vertikal kommunizieren, nehmen Gespräche primär über Status und Reviergrenzen wahr. Werden diese Aspekte nicht angesprochen, fühlen sie sich nicht wirklich erreicht.
Horizontale Kommunikation: Hier stehen inhaltliche Argumente und Zugehörigkeitsbotschaften im Fokus. Anstelle von Status und Prestige geht es um funktionale Interessen. Entscheidend ist die Qualität des verbalen Austauschs, und Sachfragen werden direkt adressiert.
Die Herausforderung des Miteinanders
Treffen Menschen, die auf Argumente setzen (horizontale Kommunikation), auf Personen, die Rangbotschaften priorisieren (vertikale Kommunikation), kommt es unweigerlich zu Spannungen. Ein Paradebeispiel dafür war der Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump: Während Clinton sich um präzise Argumente bemühte, setzte Trump gezielt auf hierarchische Kommunikation. Doch darauf komme ich an anderer Stelle noch einmal zurück.
Drei Eskalationsstufen im vertikalen Kommunikationssystem
Wenn Interessen aufeinandertreffen, eskaliert die vertikale Kommunikation typischerweise in drei Stufen:
Basis-Regel: Angriffe lassen sich nur abwehren, wenn man auf der gleichen Ebene bleibt oder eine höhere einnimmt, nicht andersherum. Quelle: "Mit ignoranten sprechen", Peter Modler
Ebene 1: High Talk
Auf dieser Ebene dreht sich alles um den Austausch von Argumenten. Der Diskurs bleibt sachlich, wenn auch mit einer gewissen Schärfe. Fachwissen und Bildung sind hier entscheidend – wer mehr Wissen und bessere Argumente hat, setzt sich durch. Dieser High Talk ist intellektuell geprägt und stark auf Inhalte fokussiert. Für horizontal Kommunizierende ist dies die einzig sinnvolle Art des Gesprächs, da sie auf Wissen und Logik basiert.
-> Doch in Auseinandersetzungen mit vertikal Kommunizierenden kann diese Form wirkungslos bleiben. Wer hier nicht weiterkommt, wechselt zur nächsten Stufe: dem Basic Talk.
Ebene 2: Basic Talk
Hier dominieren kurze, einfache Sätze ohne komplexe Argumentationsketten. Wiederholungen sind häufig, und Fragen werden nicht direkt beantwortet, sondern durch neue Themen umgangen.
Ebene 3: Move Talk
Auf dieser höchsten Eskalationsstufe spielt Sprache kaum noch eine Rolle. Stattdessen dominieren Körpersprache, demonstratives Verhalten und Ignoranz. Kopfschütteln, Augenrollen, lautes Schnauben oder bewusste Bewegungen im Raum – bis hin zum demonstrativen Verlassen – senden klare Signale von Ablehnung oder Überlegenheit.
⚡️Der blinde Fleck
Horizontal Kommunizierende halten High Talk oft für die einzig legitime Form der Auseinandersetzung. Dabei übersehen sie, wenn ihr Gegenüber längst auf eine andere Eskalationsstufe gewechselt ist. Während sie noch versuchen, logisch zu argumentieren, hat die andere Seite bereits auf Basic Talk oder Move Talk umgestellt – oft mit verheerender Wirkung. Solche Missverständnisse entstehen teils unbewusst, doch sie werden auch gezielt genutzt. Besonders dann, wenn eine Seite weiß, dass sie argumentativ unterlegen ist, weicht sie bewusst auf andere Kommunikationsebenen aus, um die Diskussion in eine für sie vorteilhafte Richtung zu lenken.
🤬 Die Ohnmacht der Argumente
Donald Trump perfektionierte das Prinzip des Ignoranten. Wenn ihm nichts einfiel, wiederholte er einfach seine Aussagen. High-Talk-Argumente konterte er mit knappen, simplen Sätzen – direkt, wirkungsvoll. Als Clinton ihm damals vorwarf, von der Finanzkrise profitiert zu haben, antwortete er nur: „Das nennt man Business.“ Oder nach einem langen Monolog: „Typisches Politiker-Gerede – hört sich gut an, klappt nie.“
Warum konterte Clinton nicht ebenso einfach? Ein Satz wie „Hört sich gut an. Klappt ständig.“ hätte gereicht. Doch Intellektuelle wechseln ungern auf eine solche Ebene – aus Prinzip, aus Stolz oder weil sie ihnen zu simpel erscheint. Dabei ist genau diese Einfachheit oft entscheidend. Nur Recht zu haben, reicht nicht – man muss sich auch durchsetzen.
In ihrem Buch „What Happened“ beschreibt Clinton später ihre akribische Vorbereitung. Sie kannte jedes Argument, war bestens geschult – eine Musterschülerin. Doch sie übersah das Wesentliche: Trump spielte nach anderen Regeln. War es Naivität oder fehlendes Gespür, das sie daran hinderte, sich darauf einzulassen?
Meine persönliche Erfahrung mit den Eskalationsstufen
Vor einigen Jahren unterrichtete ich ausnahmsweise bei Marketingstudierenden als Lehrbeauftragte einen Kurs zur Arbeits- und Organisationspsychologie im Studium Generale. Schon in der Auftaktveranstaltung provozierte ein Student mit Basic und Move Talk – spielte mit dem Handy, verließ den Raum immer mal wieder und erklärte: „Das Thema ist doch sinnlos für unser Studium.“ Meine Reaktion? Ein zehnminütiger Monolog voller Begeisterung und Argumente, warum der Kurs großartig sei. Seine? Ein Blick aus dem Fenster. Mein High Talk lief ins Leere.
Diese Erfahrung brachte mich (wieder) zu Peter Modlers Buch. Sechzehn Monate später stand ich erneut vor einem Studenten, der den Kurs infrage stellte und demonstrativ Desinteresse zeigte. Doch diesmal reagierte ich anders: Ich schwieg. Nach einer gefühlten Ewigkeit ging ich langsam zur Tür, öffnete sie ganz weit, schaute ihn an, ging auf ihn zu und sagte: „Lucas (Name ist geändert.), du sitzt hier freiwillig. Überleg dir, ob du die Tür jetzt von innen oder außen zumachen willst. Wir warten.“
Kein langes Erklären, keine Rechtfertigung – stattdessen Basic Talk und Move Talk. ☺
Fazit
Die Taktik eines Ignoranten ist nicht schön, aber effektiv – besonders dann, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt wird. Ob bewusst oder reflexartig eingesetzt, spielt dabei keine Rolle. Diejenigen, die ausschließlich auf Argumente setzen, verlieren, weil sie nur einen Teil der kommunikativen Bandbreite nutzen.
„Wer in einer politischen Debatte konsequent und kontinuierlich die intellektuellen Argumente des Gegenübers mit Move Talk beantwortet, könnte ein Ignorant sein. Wer in der Konfrontation mit einem rang- und revierorientierten Gegenüber ausschließlich auf differenzierten Diskurs setzt, ist es aber ebenfalls.“ Peter Modler
Ein intelligenter Umgang mit Kommunikation bedeutet, flexibel zu agieren. Wer nur auf einer Stufe verharrt, wird in bestimmten Situationen unweigerlich unterlegen sein. Deshalb braucht es eine Art „sprachliche Zweisprachigkeit“: Die Fähigkeit, sich je nach Gesprächspartner auf die passende Kommunikationsebene einzulassen – zumindest so lange, bis man Gehör findet und respektiert wird.
Autorin: Barbara Kolocek, Dozentin Arbeits- und Organisationspsychologie, Trainerin, Moderatorin, arbeitneudenken.org
->Hier kannst du dich mit ihr bei LinkedIn vernetzen
Buchquelle: Mit Ignoranten sprechen - Wer nur argumentiert, verliert, Peter Modler, Campus Verlag
Lesenswerte Impulse, Videobeispiele aus der Politik, eine Podcastaufzeichnung mit Peter Modler u.vm. zum Thema auch hier im Artikel vertikale und horizontale Kommunikation: Von Basic, Move und High Talk; https://digitaleneuordnung.de/blog/vertikale-und-horizontale-kommunikation
Über die Autorin

Barbara Kolocek
Barbara Kolocek befasst sich seit über 10 Jahren mit den Zukunftsfragen zum Wandel der Arbeitswelt. Nach Stationen beim Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), Axel Springer und zuletzt in einem Start up, hat sie sich selbständig gemacht und begleitet seitdem Unternehmen im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung. Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen in Team- und Kommunikationstrainings. Wenn sie mal nicht bei den Wirtschaftsunternehmen vor Ort ist, moderiert sie diverse HR-Events oder engagiert sich in der Wissenschaft und Lehre. Sie ist Co-Herausgeberin des beim Springer Gabler Verlag erschienenen Buches „Arbeitswelt der Zukunft“ und arbeitet nebenbei als Dozentin für diverse Themenfelder im Kontext “Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie” an der SRH Berlin/NRW und der Hochschule Fresenius.