Learning & Development 2030 – Lernen gemeinsam neu denken
20.11.2025 | ThinkTank Learning & Development

Fünf Jahre ist es her, dass der ZP Think Tank Learning & Development seine ersten fünf Thesen zur Zukunft des Lernens formulierte, als Orientierungspunkt für 2025. Nun ist dieses Jahr erreicht, und es war Zeit, die im Team entwickelten Annahmen mit der Realität zu spiegeln. Was hat sich bewahrheitet? Was hat sich überholt? Und worauf steuert Lernen im kommenden Jahrzehnt zu?
Um diese Fragen fundiert zu beantworten, hat der Think Tank in diesem Jahr Workshops auf mehreren Stationen der Zukunft Personal in Stuttgart, Hamburg und Köln, sowie auf der Personalmesse München durchgeführt. Dort wurden die ursprünglichen fünf Thesen mit vielen engagierten Teilnehmenden diskutiert, bewertet und weiterentwickelt.
Aus diesen Gesprächen entstand ein bemerkenswert differenziertes Bild, das zeigt, wie weit oder auch nicht Learning & Development in den vergangenen fünf Jahren tatsächlich gekommen ist und wohin es sich bewegt.
Die Bestandsaufnahme: Welche These trägt – und welche nicht mehr?
These 1: Digital wird zum New Normal
Die Community bestätigte den Kern der These einstimmig: Digitales Lernen ist heute selbstverständlich. In den Workshops wurde kaum noch darüber diskutiert, ob digitale Formate funktionieren, vielmehr darüber, dass sie inzwischen die Grundlage für Lernprozesse bilden. Blended Learning und KI-gestützte Tools gelten als Standard. Viele Teilnehmende sagten offen, die These könne „eigentlich gestrichen“ werden, da sie zu trivial geworden sei.
Wer von digitalem Lernen spricht, muss Künstliche Intelligenz mit einbeziehen. KI-basierte Lernunterstützung und dezentrale Lernumgebungen werden häufig nicht einmal mehr als Zukunft, sondern als Gegenwart beschrieben. Diese Entwicklung, in der Lernen vielfach als Kommunikation mit einer Maschine erfolgt, wird angesichts des Fortschritts der Künstlichen Intelligenz weiter voranschreiten. Gleichzeitig funktioniert Digitales Lernen vor allem dann, wenn Menschen eine Kultur und Strukturen vorfinden, die es ermöglichen (Stichwort: Lernkultur) und die Orientierung geben. Diese Verbindung von Technologie und menschlicher Verankerung war quer über alle Veranstaltungen hinweg ein starkes Motiv.
These 2: Evidenzbasiertes Lernen
Inhaltlich wurde diese These in den Workshops immer wieder bestätigt, aber deutlicher an ethische und datenschutzbezogene Anforderungen gekoppelt. Die Community forderte etwa mehr Transparenz bei Learning Analytics, eine stärkere Kopplung von Lernzielen an Business Impact, Berücksichtigung sozialer und nicht nur fachlicher Kompetenzen und auch eine bessere Sichtbarkeit informellen Lernens.
These 3: Technologie und Eigenverantwortung
Die Diskussionen zeigten, dass die Technologie Individualisierung ermöglicht, den Lernprozess aber nicht ersetzen wird. Ein wiederkehrender Impuls: „Menschen müssen wieder lernen, zu lernen.“ Die Selbstlernfähigkeit ist, anders als vielleicht zu erwarten gewesen wäre, nicht unbedingt ausgeprägt. Das gilt demnach auch, oder sogar insbesondere, für die jüngeren Generationen.
Viele Teilnehmende beschrieben Ad-hoc-Lernen als wachsendes Phänomen, ausgelöst durch schnelle Veränderungen und die Möglichkeiten der KI. Gleichzeitig machten sie deutlich, dass Technologie nur dort steuert, wo Menschen keine Haltung zum eigenen Lernen entwickeln und dabei Verantwortung übernehmen.
These 4: Lernen wird strategisch – und zum Wettbewerbsfaktor
Die Sessions bestätigten die These eindeutig: Lernen ist ein strategischer Hebel, nicht eine HR-Option.
Als zentrale Punkte stellte die Community fest: Lernen sichert die Zukunftsfähigkeit („Lernen ist Überleben“), muss aber auch mit der Entwicklung Schritt halten. Die seit vielen Jahren gestellte Forderung, dass L&D mit dem Business auf Augenhöhe zusammenarbeiten, muss Realität werden, um mit den Veränderungen Schritt zu halten. Dafür braucht es auch das Empowerment durch das Top-Management. Dabei, dieses Ziel zu erreichen, könnte auch helfen. Lernen als Geschäftsmodell zu begreifen.
Daraus entsteht ein erneuerter Gedanke: Lernen ist Teil der Kulturstrategie – nicht nur der HR-Strategie.
These 5: Heterogenität wird zur größten Herausforderung
Über alle Workshops hinweg war dies einer der emotionalsten Punkte. Unterschiedliche Lernvoraussetzungen, Zielgruppen, Sprachen und Erwartungen erzeugen eine Komplexität, die Organisationen aktiv adressieren müssen.
Die Community forderte eine kluge Reduktion („Raus aus der Komplexität durch Klarheit“), individuelle Lernpfade statt vereinheitlichter Formate, hybrides Lernen als Normalfall und Social Learning als unverzichtbaren Bestandteil.
Was diese Ergebnisse über Lernen 2030 verraten
Auf Basis der Diskussionen, der dokumentierten Reflexionen und der gemeinsamen Standortbestimmung beginnt der Think Tank nun, die Thesen für 2030 zu formulieren. Sie sind bewusst noch nicht veröffentlicht, weil der Prozess weiterläuft und die Workshops nur ein erster Baustein waren.
Aber eines zeichnet sich klar ab – ohne Inhalte vorwegzunehmen: KI wird die Infrastruktur des Lernens prägen und menschliche und maschinelle Intelligenz stärker verschmelzen. Die Chance für L&D könnte in einer Funktion liegen, die Orientierung, Moderation und kulturelle Reife ermöglicht.
Der Think Tank betrachtet alle Facetten des Lernens: von individuellem Lernen über Team- und Organisationsentwicklung bis zur Frage, wie Menschen und KI gemeinsam arbeiten.
In den Workshops wurde diese Bandbreite sichtbar. Viele Impulse kamen nicht aus theoretischen Debatten, sondern aus Praxisbeispielen der Teilnehmenden. Sie berichten, wie Teams KI-Bots bereits für Problemlösung und Wissensarbeit nutzen, wie Lernziele in ihren Unternehmen heute in Geschäftsmodelle überführt werden, wie soziale Aspekte und Zugehörigkeit im digitalen Raum neue Bedeutung bekommen oder wie Organisationen Lernräume schaffen, die Orientierung und Verbindung ermöglichen – oder eben auch nicht. Die großte Beteiligung bis hin zu ausgebuchten Workshops zeigen uns, wie groß die Bereitschaft, vor allem aber auch das Bedürfnis ist, sich über Unternehmensgrenzen und Branchen hinweg auszutauschen, voneinander zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Das wollen wir weiterführen.
Ausblick: Weiterdenken auf der Online Educa Berlin
Die Ergebnisse aus dem Workshopjahr bilden die Grundlage für den nächsten Schritt.
Auf der Online Educa in Berlin am 4. Dezember wird der Think Tank die Zwischenstände vorstellen und gemeinsam mit den Teilnehmenden weiter verdichten.
Über die Autor:innen

Prof. Dr. Anja Schmitz
Anja Schmitz ist Professorin und Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs Human Resource Management an der Hochschule Pforzheim. In ihrer Forschung untersucht sie, wie sich das Lernen in Organisationen verändert und wie Lernende am besten unterstützt werden können. Als Referentin und Autorin beschäftigt sie sich mit den Themen New Work, New Learning und Learning Ecosystems. Sie engagiert sich als Beiratsmitglied in verschiedenen Organisationen, z.B. im Global Advisory Board der Online Educa Berlin (OEB), im Advisory Board und im Think Tank Learning der Messe Zukunft Personal. Zuvor war sie in verschiedenen Positionen in den Bereichen Personal- und Organisationsentwicklung tätig.

Gudrun Porath
Gudrun Porath ist freie Journalistin (Redaktionsbüro Porath) und Moderatorin. Die studierte Kulturwissenschaftlerin arbeitete für Tageszeitungen, bis sie 1999 zu einem jungen Software-Unternehmens wechselte und dort unter anderem nach dem Börsengang die Finanzmarktkommunikation verantwortete. 2005 machte sie sich als Journalistin selbstständig und spezialisierte sich auf die Themen digitales Lernen und Weiterbildung, über die sie seitdem für Fachzeitschriften schreibt und live oder online Veranstaltungen moderiert. Sie gehört zum Redaktionsteam der Zeitschrift "neues lernen". Auf haufe.de erscheint ihre E- Learning-Kolumne.
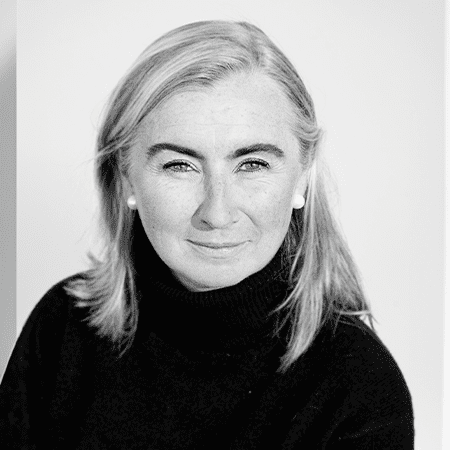
Margitta Eichelbaum
Margitta Eichelbaum ist Wirtschaftswissenschaftlerin und arbeitet als Dozentin, Moderatorin und Projektmanagerin in den Bereichen Personal, Marketing und Kommunikation. Sie ist ein kreativer Kopf und mehr Generalistin als Expertin. Den Grundstein legte eine kaufmännische Ausbildung in Hamburg und ein Universitätsstudium in Augsburg. Danach folgten drei große Unternehmensstationen bei Beiersdorf, PriceWaterhouseCoopers und IBM. Heute, mit 30 Jahren Berufserfahrung, ist sie freiberuflich tätig und arbeitet strukturiert und zielorientiert im Büro, im Home-Office, an Hochschulen und im Hörsaal mit unterschiedlichsten Menschen wertschätzend im Team zusammen.
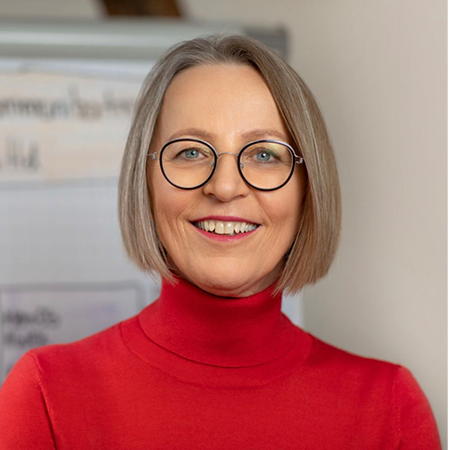
Pivi Scamperle
Als systemische Organisations-Entwicklerin und Coach unterstütze ich Menschen und Organisationen, um in Veränderungs-Bewegung zu kommen. Denn nur da, wo Bewegung ist, kann Veränderung auch wirklich gelingen. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Ohne eine Bewegung gibt es keine Veränderung. Sie ist der erste Schritt. Um Change- und Transformationsprozesse erfolgreich zu gestalten und in neues Handeln zu kommen. Sich auf den Weg der Veränderung zu machen heißt, sich weiterzuentwickeln. Denn Menschen und Organisationen brauchen dafür einen Raum, um - innere Beweggründe und Emotionen zu verstehen und als Ressource für Veränderung zu nutzen. - mit Lösungen zu experimentieren und Handlungsmöglichkeiten zu erproben, die die Dinge dann in Bewegung bringen. - Methoden, Techniken und Erfahrungen zu erlernen, die Ihre Stärken und Lösungskompetenzen verbessern, so dass Sie die notwendige Beweglichkeit für agiles Handeln erlangen.

Sven Semet
Sven Semet ist in der HR Szene als Diplom-Informatiker ein Exote, der jedoch schon seit 2006 mit innovativen Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data, ChatBots, AR/VR, Cloning, Digitale Assistenten, uva. die Personalmanagement-Prozesse in vielen Unternehmen optimiert. Seit 2019 ist Sven Semet bei der Firma ASSIMA für das Business Development verantwortlich und revolutioniert mit den patentierten Technologien von ASSIMA die Learning & Development Lösungen vieler Unternehmen. Gerne teilt Sven Semet seine Erfahrungen im persönlichen Austausch als Speaker, Workshop-Host, Interviewpartner oder Unternehmensexperte.